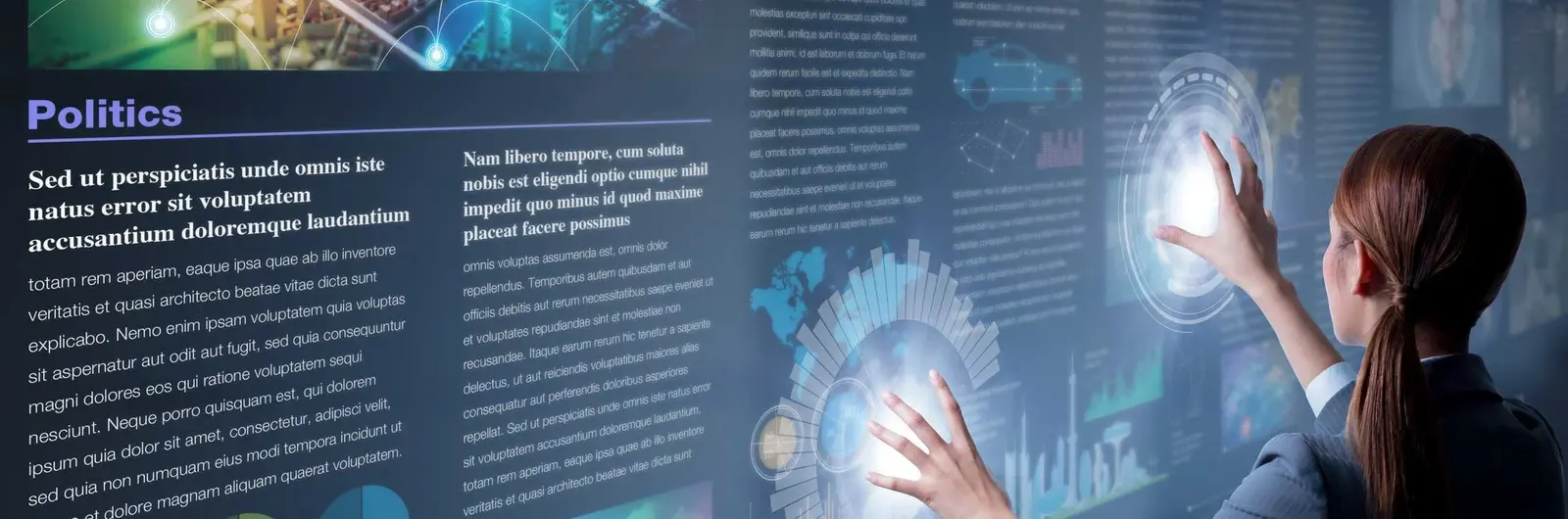Aktuelles aus der Praxis
Änderung der Sprechzeiten am Donnerstag
Ab November 2024 findet die Nachmittagssprechstunde am Donnerstag von 13-17 Uhr statt.
Operatives Versorgungsspektrum erweitert
Die Orthopädie & Unfallchirurgie Regenstauf bietet Ihnen ab sofort ein deutlich erweitertes Spektrum an Operationen an. Informieren Sie sich über unsere OP-Möglichkeiten wie künstlicher Gelenkersatz an Knie-, Hüft- und…
Chefarzt für Orthopädie und Unfallchirurgie jetzt Praxispartner
Der Orthopäde und Unfallchirurg Dr. med. Thorsten Cedl erweitert seit 01.01.2024 das orthopädisch-unfallchirurgische Spektrum der Orthopädie Regenstauf.
Der Name der 1994 gegründeten Praxis ändert sich in folgerichtig in…
Zweitmeinungsverfahren von Kassen zugelassen
Unsere Praxis ist von den Krankenkassen ermächtigt, das sogenannte Zweitmeinungsverfahren für Schulteroperationen sowie für die Implantation von künstlichen Kniegelenken durchzuführen. Patient*innen können sich also nochmals…